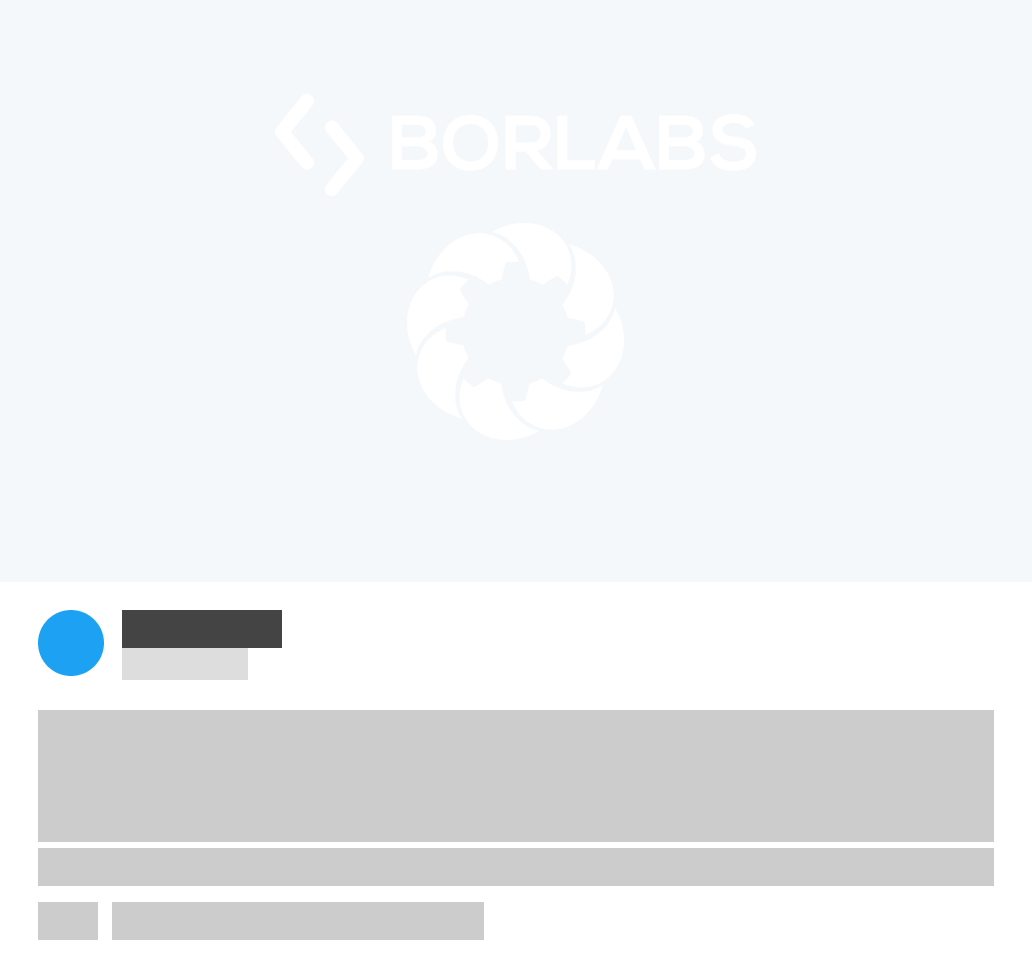Sandra Ottos Leidenschaft ist das Laufen. Doch nach einem Arzttermin bricht ihre Welt zusammen: Brustkrebs im fortgeschrittenen Stadium! Doch aufgeben wollte und konnte sie nicht. Das Laufen blieb auch während der Akutbehandlungen eine Konstante.
Im Oktober 2010 ertastete ich einen Knoten in meiner Brust. Völlig aufgelöst suchte ich eine Gynäkologin auf. Sie beruhigte mich nach einem ausführlichen Anamnesegespräch, Abtasten und Ultraschall mit der Diagnose: Zyste. Unendlich erleichtert verließ ich die Praxis. Wie konnte ich auch auf die Idee kommen, es wäre etwas anderes: Ich, die ich doch sportlich, gesund und fit war, keine Herausforderung scheute.
“Ich sah mich bereits sterben”
Ein Jahr und ein paar Untersuchungen später stand am 29. September 2011 völlig unerwartet die Diagnose Brustkrebs im Raum. Ich, die ich doch vor einem Monat noch den “Cospudener Seelauf” gewonnen und den “Mitteldeutschen Halbmarathon” zwei Wochen zuvor in Halle/Saale einfach nebenher mitgenommen hatte. Ein Radiologie-Termin mit Stanzbiopsie am 30. September 2011 ließ auch den letzten Hoffnungsfunken erlöschen. Immerhin waren meine inneren Organe wie Lunge, Leber und Nieren noch nicht befallen.
Mit jedem schmerzhaften Atemzug rannen mir die Tränen über die Wangen. Wie sollte ich das verlängerte Wochenende durchstehen: Alle jubilierten ob des freien Montags, dem 3. Oktober 2011, und ich sah mich bereits sterben. Erstmals meldete ich mich bei meinem Arbeitgeber am 30. September 2011 krank. Nachts hatte mich mein Mann fest in den Arm genommen, und wir heulten gemeinsam.
Trotzdem wollte ich den Radiologie-Termin allein durchstehen. Mein Mann benötigte Routine und Ablenkung durch den Job, und ich musste mich mit meinem neuen Leben zurechtfinden. Ich hatte keine wirkliche Vorstellung, was mich erwarten würde. Allerdings spürte ich in mir, dass die Kraft zum Kämpfen und Lebenwollen aus mir kommen musste.
Podcast mit Sandra Otto: “Laufen ist ein Teil von mir”
Erster Lauf nach der Diagnose
Am Morgen des Radiologie-Termins war ich körperlich am Ende, mental ausgelaugt. Ich brauchte Ablenkung und musste mich spüren können. Also zog ich die Laufschuhe an, um eine Runde um meinen Haussee zu drehen. Weniger als 24 Stunden zuvor hatte ich die Runde erst absolviert.
Innerlich beschäftigt war ich damals mit Budgetzahlen, dem anstehenden Bowling-Termin mit den Kolleg*innen, dem 70. Geburtstag meines Vaters. Jetzt, wenige Stunden später, nahmen mir die Tränen die Luft für die Lungen. Ich keuchte, wischte Tränen ab, die Nase tropfte und ich lief weiter. In meinem Kopf hämmerte nur noch: “Krebs, Tod, Krebs, Tod: wann, warum ich?”
Ungefähr nach der Hälfte der Seerunde hatte ich meinen Kopf so weit ausgepowert, dass ich nur noch keuchte. Die Tränen versiegten. Ich spürte, wie die morgendliche Herbstkälte meine Stirn kühlte. Leichter Modergeruch des ersten bunten Laubs weckte meine Nase. Die Vögel um mich her zwitscherten. Der Verkehrslärm der A38 kroch langsam in mein Gehör. Ich begriff: Das Leben geht weiter, mit mir und ohne mich.
Immer wieder spazieren und heulen
Ich brauchte Abstand, um mich innerlich zu sortieren. Also beschloss ich, am geplanten Ablauf der Folgetage festzuhalten. Dies bedeutete, am Folgetag den 70. Geburtstag meines Vaters zu feiern, meinen Mann am Sonntag vom “Cross de Luxe” abzuholen, den 3. Oktober zu überstehen und am 4. Oktober eine Ahnung vom weiteren Vorgehen zu erhalten.
Bei meinen Eltern angekommen, wäre ich ihnen gern aus tiefstem Herzen um den Hals gefallen, wollte heulen. Aber ich beschloss, meinem Vater nicht diese – mit viel Liebe und aus einfachsten Mitteln durch Freund*innen und Nachbar*innen organisierte Feier – zu verderben. Er war so stolz auf mich, meine gerade abgeschlossene Promotion. Aus seinem Blick sprach unendliche Liebe. Doch ich benötigte auch nervliche Pausen. So gingen mein Mann und ich im Tagesverlauf immer wieder spazieren, heulten, drückten unsere Hände.
Meinem Mann musste ich am Folgetag gut zureden, zum Wettkampf zu gehen. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel. Ich selbst nutzte den Sonntag für einen langen Lauf entlang der Luppe durch den Clara-Zetkin-Park in Leipzig, über den Fockeberg zurück nach Markkleeberg.
Mit jedem Laufschritt nahm ich Abschied von dieser lieb gewonnenen Strecke, die ich als so selbstverständlich wahrnahm. Den Feiertag brachten mein Mann und ich mit einem langen Spaziergang hinter uns. Ich musste mich körperlich verausgaben, um nachts wenigstens ein paar Stunden Ruhe zu finden.
Am Dienstag ging ich ohne Anmeldung oder Überweisung direkt in das Brustzentrum des Uniklinikums Leipzig. Verständlicherweise mit Wartezeit wurde ich kompetent und nach Einholung der bereits vorhandenen Befunde der Radiologie von der Oberärztin empfangen. Es sah nicht gut aus. Der Tumor hatte einen Durchmesser von sieben Zentimeter, wuchs sehr schnell und bot nur wenig Angriffsflächen für eine Chemotherapie. Es handelte sich um eine sehr aggressive Variante, den sogenannten “triple-negativen Brustkrebs”.
Der Plan: Operation und Chemotherapie
Der Standardschlachtplan sah zunächst einen kleinen operativen Eingriff vor, um den Wächterlymphknoten und weitere suspekte Lymphknoten zu entfernen. Mit diesem Schritt sollte festgestellt werden, ob mein Mammakarzinom bereits gestreut hatte oder noch lokal behandelbar blieb. Unabhängig davon schloss sich eine neoadjuvante Chemotherapie an. Hierdurch sollte der Tumor verkleinert werden. Eine Reaktion des Tumors würde auch vom positiven Anschlagen der Chemotherapie zeugen.
Trotzdem machte mir die Oberärztin wenig Hoffnung auf eine brusterhaltende Operation, da der Tumor sehr groß war und bereits mindestens ein Jahr Zeit hatte, sich auszubreiten (sogenannte Angiongenese; hier bildet der Tumor kleine Wurzeln zum umliegenden gesunden Gewebe und zapft dieses für weiteres Wachstum an). Mein schmaler Körperbau mit Körbchengröße 70A begründete ein weiteres K.-o.-Kriterium für eine brusterhaltende Operation. Nach der Chemotherapie stand die eigentliche Entfernung des Tumors an.
Den Abschluss der Akutbehandlung bildete die obligatorische Bestrahlung. Alles in allem sollte ich von etwa sechs Monaten Akutbehandlung und weiteren zwei Monaten Bestrahlung ausgehen. Allerdings mussten mein Körper und meine Psyche mitspielen.
Letzter Staffellauf vor der Chemo
Krampfhaft suchte ich nach einer Konstante in meinem Leben. Der Sport, insbesondere das Laufen, prägte seit über zehn Jahren meinen Lebensalltag. Die Oberärztin befürwortete dies und meinte, mein Körper würde mir selbst ein Stopp-Signal senden. Meine Bedenken über das Aufplatzen möglicher Operationsnarben wischte meine Ärztin mit der Bemerkung weg, dass man diese wieder zunähen könnte. Diese pragmatische Ehrlichkeit nahm mir ein Stück meiner Befürchtungen. Meine bohrenden Fragen nach einer Überlebensprognose blieben unbeantwortet. Zum damaligen Zeitpunkt wäre jede Aussage unseriös gewesen, wie ich heute endlich verstehen kann. Mental war ich mehr als nur angeknackst.
Bereits am 6. Oktober wäre die Entfernung der Lymphknoten möglich. Ausgerechnet im Oktober nehmen mein Mann und ich traditionell am Staffelmarathon in Dierhagen teil. Hieran wollte ich festhalten, und die Oberärztin meinte, dass es auf eine Woche früher oder später nicht ankommen würde. Der Lauftag des Staffelmarathons selbst grüßte mit strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Wie immer lief ich die ersten vier Runden der Strecke, mein Mann übernahm den zweiten Teil.
Ich sehe noch heute jeden Maulwurfshügel auf der Startwiese vor mir. Wurzeln, die es auf den Moorpfaden zu beachten galt, den Strandabgang zum Meer, rund 500 Meter entlang der Ostsee, die Sanddüne wieder hinauf durch aufgeschüttetes Heu und Gras. Danach hinein in das Ribnitzer Moor, auf dessen Pfaden es galt, nicht über Baumwurzeln zu stolpern, zurück über breite Waldwege bis zur Festwiese im Zielbereich. Insgesamt vier Runden atmete mein noch nicht von der Chemotherapie belasteter Körper die Atmosphäre des Staffelmarathons. Für einige Momente konnte ich innerlich abschalten, den Lauf genießen, meinen doch gut funktionierenden Körper spüren.
Meine innere Zerrissenheit spiegelte sich allerdings in den schwankenden Laufrundenzeiten wider. Untypisch für mich, da ich sehr konstant laufe und die Uhr nach mir gestellt werden kann. Mit meinem vermeintlich letzten Zieleinlauf übergab ich an meinen Mann. In der Kategorie Paarlauf belegten wir den zweiten Platz und landeten insgesamt im Mittelfeld.
Mein Entschluss: jeden Tag zwei Stunden bewegen
Jetzt war es vollbracht, und ein neues Lebenskapitel begann für mich: Am Dienstag checkte ich stationär ein. Eine Psycho-Onkologin nahm mir meine letzte mentale Kraft. Ich wollte alles über die Krankheit und die mir verbleibende Lebenszeit erfahren. Doch ich erhielt von der Psychologin ein Buch, das mir den Eindruck vermittelte, lieber ein Testament zu schreiben, als zu kämpfen.
Einerseits ließ ich mich hängen, andererseits versuchte ich, dem Krankenhausalltag zu entfliehen. Ich spazierte täglich verbotenerweise durch einen nahe gelegenen Park. Jede Runde (ein Kilometer lang) führte – wenn ich wollte – sogar über einen kleinen Hügel. Aus einem inneren Impuls heraus fasste ich den Entschluss, mich täglich mindestens zwei Stunden in irgendeiner Weise an der frischen Luft zu bewegen. Ich konnte die Jogger*innen und Spaziergänger*innen, die Vögel und die fallenden Blätter beobachten. Je fitter ich vor und während der Akutbehandlung blieb, desto leichter würde mir der Einstieg in die Laufroutine fallen. Vielleicht müsste ich diese gar nicht aufgeben?
Am Donnerstag wurde mir unter örtlicher Betäubung der Port für die Chemotherapie gelegt, rechts unter das Schlüsselbein, direkt neben die Lunge. Ich hörte tatsächlich ein “Pffff”, als der chirurgische Schnitt erfolgte und der Port in die Wunde gedrückt wurde.
Kaum dass ich wieder aufstehen durfte, aß ich völlig ausgehungert das kalte Krankenhausmittags-Menü und spazierte auf wackeligen Beinen und im schicken Krankenhaus-Nachthemd unter Jeans und Strickjacke bereits wieder durch den Krankenhaus-Park. Abends verließ ich mit meinem Mann verbotenerweise sogar das Gelände und ging zum Frisör. Es galt, meine Zweitfrisur zu planen.
Langsam ließ die Narkose nach, die Wunde schmerzte und pochte. Doch auch nachts verzichtete ich auf Schmerz- und Schlafmittel und versuchte, es mir im Krankenhausbett erträglich zu machen. Jede unnötige Medizin wollte ich um der Gesundheit willen vermeiden. Verrückt, aber so ticke ich auch heute. Am Folgetag dann die Entfernung der Lymphknoten unter Vollnarkose. Dies war überhaupt die erste richtige Operation meines Lebens, der erste bewusste Krankenhausaufenthalt für mich. Nach der OP wieder auf meinem Zimmer angekommen, las ich in dem Buch der Psychologin, wie schlecht es für mich aussah. Mein Mann fand mich als heulendes Elend vor, das über den Krankenhausflur schlich.
Ich will nicht klagen, sondern leben
Wie früher im Ferienlager empfand ich Heimweh. Ich erkannte mich nicht wieder. In den Tagen darauf bettelte ich um eine Entlassung. Obwohl ich den Umständen entsprechend in guter körperlicher Verfassung war, blieb ich drei weitere Tage auf der Station. Täglich erweiterte ich meine Runden durch den Park. Manchmal suchten mich die Schwestern, und ich erhielt Mahnungen, weil ich nicht auf dem Gelände geblieben war. Doch ich nutzte jede Gelegenheit mehrmals am Tag für die Bewegung an der frischen Luft, um auf meine zwei Stunden zu kommen.
Ich wollte mich von den anderen Patient*innen abgrenzen, wollte nicht vor Schmerzen klagen, sondern leben. Ich stellte mir vor, mit jedem Schritt an der frischen Luft meinem Leben noch eine Minute auf Erden zu schenken. Ich biss die Zähne zusammen, wenn es wehtat, probierte sogar am zweiten Tag nach der Operation so etwas wie zwei, drei zögerliche Laufschritte. Während der Visite fragte ich konkret, wann ich wieder joggen könnte. Eine Woche nach der Operation wurde mir als Zeitpunkt genannt. Ich jubelte innerlich.
Nach der Entlassung probierte ich dann doch eine erste kleine Runde von 30 Minuten zu joggen. Am nächsten Tag wagte ich vorsichtig eine Runde um den Haussee. Ich hatte Angst um die OP-Narbe unter der linken Achselhöhle, auch spannte die Wunde rechts über dem Port. Doch ich schaffte langsam in 1:25 Stunden die 13 Kilometer bis nach Hause. Mein Körper kribbelte, mein Kopf jubelte. Ich kann noch laufen. Ein potenzieller kompletter Trainingsausfall ließe sich vielleicht vermeiden. Die Operationsnähte hielten und auch die erste Wundkontrolle war okay.
Meinen täglichen Heulattacken konnte ich mich nicht ganz entziehen, doch sie wurden weniger. Auch nachts wachte ich nur noch zwei bis drei Mal auf. Ich wechselte das Laufen mit langen Spaziergängen täglich ab. Meine “Wanderungen” verband ich mit den Wegen zu Arzt- und Laborterminen, Physiotherapien, Perückenanproben sowie weiteren Untersuchungen. Das Laufen wurde zu meiner Überlebenskonstante, die mich durch alle Höhen und Tiefen begleitete.
Zur Person: Sandra Otto ist promovierte Betriebswirtin und lebt mit ihrem Mann im Süden von Leipzig. Kurz nach ihrem 34. Geburtstag erhielt sie die Diagnose Brustkrebs, 18 Monate später das Rezidiv. Dies war der Anstoß, sich für Haus Leben e. V. zu engagieren und sich aktiv für ein Umdenken in der Gesellschaft einzusetzen: Denn eine Krebserkrankung ist kein Stigma und man kann alles schaffen, wenn man den Lebenswillen nicht verliert. Für diesen Bewusstseinswandel sensibilisiert Sandra Otto in Vorträgen, Lesungen, Workshops und Beratungen.