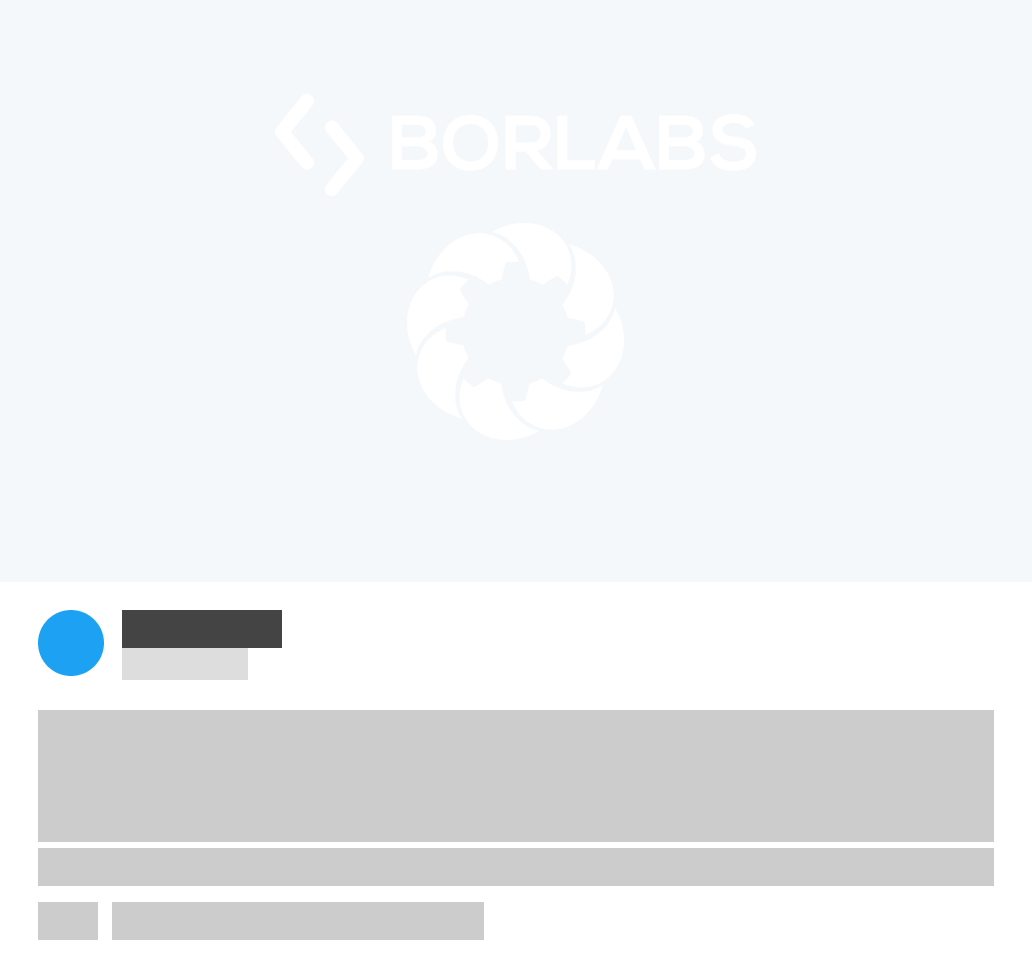Früher Leiden, heute Leidenschaft. Früher Zweifler, heute Winner. Jan Frodeno, der beste Triathlet der Welt, hat sich mental neu programmiert, ganz ohne Tschakka und Eso-Firlefanz. Eine Geschichte vom unbedingten Gewinnenwollen.
Jan Frodeno, 35 Jahre alt, geboren in Köln, 194 cm groß, 76 Kilogramm schwer, fünf Prozent Körperfettanteil, Ruhepuls 36, Maximalpuls 195.
Wie ich mich umprogrammierte
Zwei Wochen vor Peking hat es geknallt. Ich bereitete mich im Trainingslager auf der südkoreanischen Insel Jeju auf die Olympischen Spiele vor. Feinschliff. Ich lag im Halbschlaf, es war gegen halb zwei Uhr morgens. Wie jede Nacht hatte ich meine Kopfhörer aufgesetzt und hörte dieses Psycho-Tape, zum aberhundertsten Mal.
Meine Kopfbilder dazu waren in den letzten Monaten immer dieselben gewesen: Ich lag beim abschließenden 10-km-Lauf in Führung. Doch kurz vor dem Ziel war ein Konkurrent an mir vorbeigeschossen. Ich war nicht in der Lage dranzubleiben. Zweiter.
Immer und immer wieder. Für viele mag Silber eine ehrenvolle Platzierung sein. Für mich bedeutet ein zweiter Platz Niederlage, Demütigung, Versagen.
Plötzlich schreckte ich aus dem Bett hoch. Ich sprang auf, zappelte und begann wie ein Irrer durch die kleine Bude zu tanzen. Ich warf die Arme in die Luft, johlte und hüpfte. Endlich! EndlichEndlichEndlich! Zum allerersten Mal hatte ich mich in meinem Kopffilm nicht überholen lassen.
Ich wusste nicht, warum, aber zum ersten Mal war ich nicht der Loser, sondern der souveräne Sieger. Ich habe das Ding gewonnen, nicht locker, aber klar. Offenbar war mir gelungen, woran ich fast schon nicht mehr geglaubt hatte: Ich hatte mich umprogrammiert, von Zweiter auf Erster.
Tatsache: Ich war ein Weichei
Jahrelang hatte ich mich innerlich wie eine Niete gefühlt, was man Medien, Fans und Sponsoren besser nicht verrät. Tatsache war: Ich war ein Weichei. Ich ließ mich von irgendwelchen blöden Storys leiten, die in meinem Kopf herumgeisterten.
In den entscheidenden Momenten kurz vor dem Ziel knickte ich ein. Nun, als ich schon fast nicht mehr daran geglaubt hatte, war ich plötzlich ein Champion. Weil ich in meinem Unterbewusstsein erfolgreich herumgeschraubt hatte.
Zugegeben, die Story klingt ebenso simpel wie verrückt. Aber 14 Tage später hatte ich die Goldmedaille.
Seither habe ich den Ironman auf Hawaii zweimal gewonnen, bin Weltmeister über die Mitteldistanz geworden und habe die Weltbestzeit über die Langstrecke in Roth aufgestellt.
Ich habe einen Fast-Burnout durchgestanden und einen brutalen Muskelfaserriss. Ohne diesen Klick im Sommer 2008 hätte ich diese Erfolgsstrecke nicht hinbekommen.
Es gibt einige Kollegen, die mindestens so talentiert und trainingsfleißig sind wie ich, Sebastian Kienle zum Beispiel. Aber er ist dreieinhalb Minuten langsamer auf Hawaii. Lässt sich diese vergleichsweise minimale Distanz mit noch mehr Training aufholen? Ich glaube nicht.
Am bitteren Ende eines Wettkampfs, wenn wir im tiefroten Bereich unterwegs sind, entscheidet nicht mehr stärkere Körper, sondern die festere Birne. Und die habe ich mir seit Olympia 2008 systematisch neu programmiert.
Die weniger gute Nachricht: Es gibt keinen Trick. Die Sache dauert, sie strengt an, sie ist schmerzhaft.
Die gute Nachricht: Es ist möglich.
Und die allerbeste Nachricht: Mein ganzes Leben hat sich seither zum Besseren verändert.
Nach außen sind wir immer Sunnyboys
Was genau hatte ich vor Peking nun gemacht? Zunächst war mir klar geworden, dass mein Sportlerleben oftmals eine Qual war. Das Training strengte mich an, vor Wettkämpfen war ich nervös und fiel in düstere Verlierer-Phantasien. Nach außen sind wir ja immer die Sunnyboys.
Aber innendrin, da rumort es gewaltig. Nach einigen zweiten und dritten Plätzen in den Jahren 2006 und 2007 war mir klar, dass etwas passieren musste. Ich habe enge Rennen immer auf der Zielgeraden verloren: Europameisterschaft, Weltcups. Es war zum Verzweifeln.
Und ich stand vor einer fundamentalen Entscheidung: Wollte ich den Leidensweg gehen und eine Sportlerkarriere durchmachen, die wie so viele andere knapp unterhalb des Gipfels enden? Oder war ich bereit, noch einmal neu anzufangen, mit allen Konsequenzen, vor allem der, dass ich mich mir selbst stellen müsste, meinen Ängsten, meinen Schwächen, meinen eigenen Erwartungen und denen meiner Umwelt?
War ich bereit, mich ehrlich zu machen? Das mag lächerlich klingen, aber ich verspürte Panik: Was ist, wenn da etwas ganz anderes auftaucht als ich erhoffte? Was, wenn ich wirklich jenes Weichei war, als das ich mich bisweilen, wenn auch nicht immer, fühlte?
Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, für die Treppenstufen hinab in die Welt meines Unterbewusstseins, hin zu meinen Traumata, in den düsteren Keller der eigenen Seele, wo jede Menge Gerümpel aus alten Zeiten lagerte. Dieser Müll sollte ans Licht. Im Kern geht es darum, unbewusste Glaubenssätze aus der Vergangenheit hervor zu holen, die mich in Grenzsituationen womöglich bremsten.
Mein Komplex: Du kannst nicht schwimmen
Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich mir eingeredet habe, ein gescheiterter Leistungsschwimmer zu sein. Ich war 15, als ich das Schwimmen überhaupt gelernt habe.
Spitzenschwimmer haben da schon einige Jahre Training hinter sich. Obwohl ich regional ganz gut war und viel trainierte, habe ich den Anschluss an die nationale Spitze nicht geschafft. So hatte sich bei mir unterbewusst ein Versagenskomplex verfestigt: Du kannst nicht schwimmen. Die anderen sind viel besser. Vergiss es.
Solche miesen kleinen Sätze fressen sich fest und wirken im Wettkampf wie mentale Bremsen, wenn das Hirn, dieser tückische Clown, in Momenten höchster Anstrengung nach allerlei Möglichkeiten sucht, sich dem Gequäle zu entziehen.
Ich habe mich immer wieder unbewusst in solche negativen Sätze zurückfallen lassen. Aber mit Training kommt man gegen eine solche Programmierung nicht an. Denn unterbewusst ist noch härteres Trainieren nichts anderes als eine Selbstbestrafung für das eingeredete Versagen.
Ein Kampf der schlechten Gefühle
Das Ergebnis: Training macht keinen Spaß, sondern ist ein dauernder Kampf gegen das eigene schlechte Gewissen. Im Schatten der Seele tobt ein verhängnisvoller Kampf der schlechten Gefühle. Was sich aber im Unterbewusstsein verbirgt, sitzt auch in den Knochen. Ich wollte es weg haben. Raus damit.
Mit Hilfe eines Tapes, einer Mischung aus autogenem Training und Hypnose, ging ich das Problem an. Die Texte bildeten oft widersprüchliche Untertitel zu meinem Kopffilm. Denn während ich in Gedanken mal wieder ein Rennen versemmelte, sprach das Tape tapfer dagegen an.
Der Text war weder Hexenwerk noch literarisch wertvoll, eher in die Richtung: Ich kann gewinnen. Ich will gewinnen. Ich schaffe das. Nicht sehr originell, zugegeben. Und anfangs scheinbar auch nicht sehr wirkungsvoll. Ich habe dieses Tape gehört, immer und immer wieder. Aber nichts hat sich getan – bis zu dieser Nacht 2008 in Jeju, bis zum Wunder in Südkorea.
Ich bin in den Monaten davor fast verrückt geworden, weil ich dieses Trauma vom Verlieren auf den letzten Metern offenbar so tief in mir trug, dass ich einfach nicht herankam und fast daran zerbrochen wäre. Wirklich wahr.
Der Prozess dauert ein Leben lang
An dieser Geschichte kann man meine mentale Entwicklung ganz gut ablesen, vor allem den Umstand, dass es, für mich jedenfalls, keine Abkürzung für diesen Weg ins Dunkel gibt. “Mentale Fitness in 48 Stunden” das ist eine Lüge. Der Prozess dauert, nicht Monate, nicht Jahre, sondern eigentlich ein Leben lang.
Denn diese miesen Stories aus dem Unterbewusstsein sind wahnsinnig mächtig. Und sie wollen nicht ans Licht. Kopf und Körper haben sich damit ganz gut arrangiert, schließlich dienen diese Stories ganz praktisch der Schmerzvermeidung. Die Evolution hat dem Menschen Fluchtinstinkte mitgegeben, aber auch Schutzmechanismen.
Wer also über alle Grenzen gehen will wie wir Triathleten, der muss die vielen, kleinen unterbewussten Teufel besiegen, die ein maximales Verausgaben verhindern wollen. Das ist zwar nicht gesund, aber beim Kampf um eine Goldmedaille nicht zu vermeiden.
Jeder Freizeitathlet kennt doch diesen Moment, wenn der Kopf sich einschaltet, meistens so nach 30 Sekunden. Das ist ja der entscheidende Unterschied zwischen 100 und 400 Metern Sprint. 100 Meter kriegt der Körper halbwegs ohne nervende Gedanken hin.
Du siehst das Ziel, alles konzentriert sich auf die Beine, Gedanken werden weggewischt. Aber nach spätestens 30 Sekunden kommt dieses zappelige Hirn ins Spiel und fragt: “Wie lange ist denn noch? Warum tue ich mir das an? Geht´s nicht ein bisschen langsamer? Wofür der Quatsch? Ist doch egal. Schaffst Du nie.”
Dieses Mentalgift muss aus dem System raus und umformuliert werden zu einem: “Da geht noch was! Das macht Laune! Du wirst ja immer schneller!?
Muskelkrampf wegen mentaler Ermüdung
Nach neueren Forschungen sind 50 Prozent aller Muskelkrämpfe im Wettkampf nicht auf körperliche, sondern auf mentale Ermüdung zurückzuführen. Ich glaube, dass ich meine Synapsen im Hirn buchstäblich entkrampfen und umkoppeln kann, ich muss die neuen Sätze nur oft genug wiederholen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass mir diese Arbeit meine beiden Siege auf Hawaii beschert hat.
Jeder Mensch empfindet Schmerzen anders. Aber dieses individuelle Schmerzempfinden kann man umprogrammieren.
Hat nur leider mit Mut und Geduld zu tun. Die gnadenlose Selbsterforschung, das ist eine Erfahrung, die manche Menschen vielleicht noch nie gemacht haben, Leistungssportler schon gar nicht. Wir sind es gewohnt, in einer Art Superman-Modus zu leben. Schwächen? Ich doch nicht.
Um die düsteren Sätze aus Kindheit und Jugend zu finden, muss man sich ehrlich machen und ganz offen in sich selbst und seiner Vergangenheit herumforschen: Was sind die Erlebnisse von früher, aus der Schule, aus dem Sportverein, von Eltern, Geschwistern, Lehrern, Trainern, Freunden, Feinden, die bis heute bitter nachklingen? Ist ja nicht so, dass diese seelischen Verletzungen ordentlich in einer Datei abgespeichert sind.
Alte Muster besiegen, um neue Wege zu gehen
Es ist als Profi-Triathlet nicht leicht, sich einzugestehen, dass man sich tief drinnen für einen gescheiterten Schwimmer hält. Und wenn doch? Dieser Gedanke macht Angst, tut weh, ist unangenehm, weil ein sorgsam aufgebautes und gepflegtes Selbstbild erschüttert wird.
Aber es geht nicht darum, Leidensgeschichten ausfindig zu machen, um sich lebenslänglich in Traumata zu suhlen. Im Gegenteil: Diese alten Muster sind ein ganz natürlicher Teil meines Weges. Aber die Richtung des Weges bestimme noch immer ich. Und ich entscheide auch, wie viel Macht die alten Stories über mich haben oder ob ich mich davon verabschiede.
(Nur am Rande: Bis ich 29 Jahre alt war, hat meine längste Beziehung gerade mal vier Monate gedauert. Ich will jetzt nicht in die dunkelsten Ecken meiner Seele leuchten, aber es ist ja wohl offenkundig, dass da auf der Bindungsebene was unrund lief. Heute bin ich glücklich verheiratet und stolzer Vater.)
Wachstum ist möglich, fast immer und für fast jeden.
Inzwischen habe ich Frieden mit mir selbst gemacht
Mein mentaler Fortschritt bringt natürlich auch Probleme mit sich. Ich übertreibe manchmal. Wenn ich immer wieder in meinen Schmerz hineinlaufe, darf ich mich nicht wundern, wenn ich mir wie im Frühjahr 2016 einen neun Zentimeter langen Muskelfaserriss einfange, nach 20 Kilometern Laufen, also bestimmt nicht, weil ich mich nicht aufgewärmt habe.
Mein Kopf hat einfach nur die Signale des Körpers ignoriert, weil er im mentalen Überschwang nicht bremsen wollte. Zweimal bin ich im Training ohnmächtig geworden, vor Erschöpfung. Und da muss ich gleich mal ein Missverständnis aufklären: Es heißt ja immer, dann werde es schwarz vor Augen. Stimmt nicht. Es wird weiß. Ich schwöre.
Das Suchen nach alten Mustern braucht Geduld und gnadenlose Ehrlichkeit, die Bereitschaft, sich mit all den Schwächen des eigenen Ichs zu quälen, aber zugleich auch Rücksicht, Verständnis und Gelassenheit. Inzwischen habe ich Frieden mit mir selbst gemacht, ich betrachte meinen Körper nicht länger als Feind und meinen Job als Profisportler nicht als Last, sondern als Geschenk.
Heute weiß ich: Es gibt nichts, was ich lieber machen würde.
Aufgezeichnet von Achilles Running.