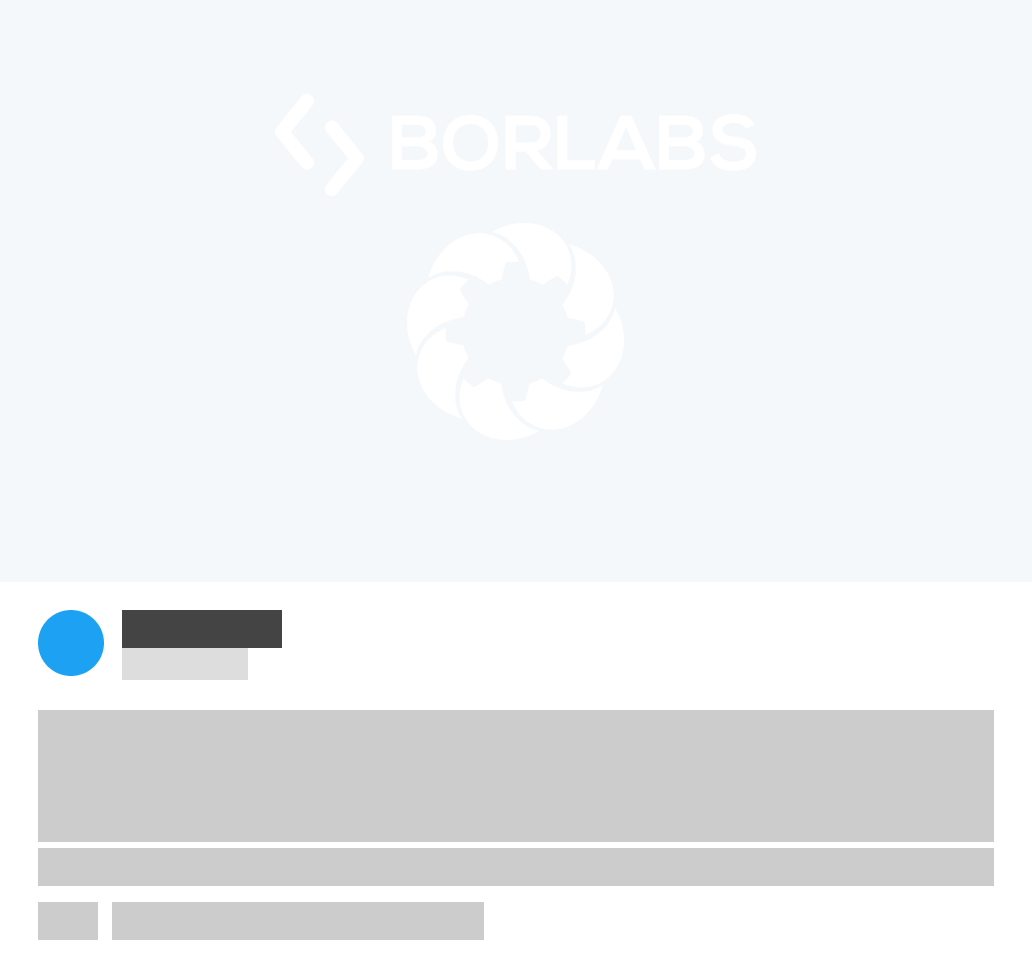Sie lassen Herzen schneller schlagen, können ganz schön weh tun und sind es am Ende eigentlich immer Wert. Unsere Redakteurin Anna schreibt, was sie an den schnellen Läufen liebt. Eine Liebeserklärung an Tempoläufe.
„Babum-bum, babum-bum, babum-bum, babum-bum,“ wummert mein Herz. Es klopft in den Ohren, im Hals, in der Brust. Ich atme tief, fülle meine stechenden Lungen mit Luft. Die Wärme der Tartanbahn wickelt sich um meine Waden, obwohl es schon 20 Uhr ist. Sie gibt meinen zitternden Beinen Halt. Mein gequälter Blick wandert zur Uhr während Schweißtropfen gelangweilte Bahnen auf meiner Stirn ziehen. Die zweiminütige Pause ist in zehn Sekunden vorbei. Dann folgen die letzten 400-Meter für heute.
Zehn, neun, acht … drei, zwei, eins.
Meine Uhr macht dieses leise Pipsgeräusch, als ich auf den Knopf drücke. Los geht’s. Ich schiebe meinen Körper in die Kurve, beschleunige so gut es geht. Immerhin stecken bereits 4×400-Meter in meinen Beinen. Diesmal beginnt die Lunge sofort zu stechen, auch wenn ich nur 85 Prozent meiner Maximalgeschwindigkeit anstrebe. Es tut weh die Beine zu heben, ist als ob ich Gewichtsmanchetten trage, die jeden meiner Schritte langsamer machen. Ich denke an meinen Sprinttrainer von damals, der mir immer etwas von „Knie hoch, nach vorne schauen!“ bei Tempoläufen entgegen schrie. Aber die Knie wollen nicht mehr hoch und mein Kopf ist irgendwo. Bestimmt nicht da wo er sein sollte.
Luft? Wo ist sie nur?
Meine Beine fühlen sich an, als hätte ich mit 100-Kilo Squats gemacht. Dabei habe ich nur vier popelige Läufchen geschafft. Ab 300-Metern wird es richtig schwer. Luft? Wo ist sie nur? In meiner Lunge kommt scheinbar nichts mehr an. Ich quäle mich weiter. „Rechts, links, rechts , links,“ ich versuche mich vom Schmerz abzulenken. Mein Gesicht sieht wahrscheinlich aus, als ob ich den Kopf bei 120 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn aus dem Fenster strecke. Die Augen sind zu Schlitzen verengt, die Lippen aufeinandergepresst. Egal, man macht keine Tempoläufe um gut auszusehen, sondern um an seine Grenzen zu gehen. „Nur noch ein paar Meter,“ sagt die Stimme in meinem Kopf. Und dann ist es auch schon geschafft.
Geschafft!
Erschöpft, lasse ich mich auf den Boden fallen, stelle die Beine angewinkelt auf. Meine Brust hebt und senkt sich. Puls? Gefühlt 1000 Schläge pro Sekunde. Ich bin erschöpft, müde, meine Beine sind Brei – und ich? Ich bin über glücklich.
Irgendwo zwischen Erleichterung, Erschöpfung und Endorphinhoch
„Verrückt“ werden manche denken, die das Grenzgefühl einer anstrengenden Tempolaufeinheit noch nicht erlebt haben. Irgendwo zwischen Erleichterung, Erschöpfung und Endorphinhoch liegt das und ist mit so gut wie nichts zu vergleichen.
Aber genau dieses Gefühl suche ich. Wenn ich es habe, weiß ich, dass ich wirklich an meine Grenzen gegangen bin. Das kommt nicht durch den metallischen Geschmack im Mund – den kann ich mir auch bei langen Läufen holen. Ich suche dieses plötzliche Stechen in der Lunge, dass mich sofort zurück auf den Schulhof katapultiert, auf dem ich mit meinen Klassenkamerad*innen Fangen spielte, bis wir alle auf dem Rücken lagen und wie Fische auf dem Trockenen nach Luft schnappten. Dieses Gefühl, das man maximal im Alltag hat, wenn man einen 100 Meter-Sprint hinlegen muss, um die U-Bahn noch zu erwischen.
Es ist die Ausgelaugtheit danach, die mir bestätigt, ich habe meinem Körper alles abverlangt. Bin an Grenzen gegangen, habe sie – wenn auch nur marginal – verschoben. Dabei habe ich mich selbst etwas besser kennen gelernt. Bei kaum einer anderen Trainingsform erlebe ich das so intensiv.
Eigentlich bei keiner.
Eigene Tempoläufe erleben?
Bock auf schneller werden und tolle Tempoläufe. Schau hier mal vorbei und genieße deinen eigenen Geschwindigkeitsrausch.