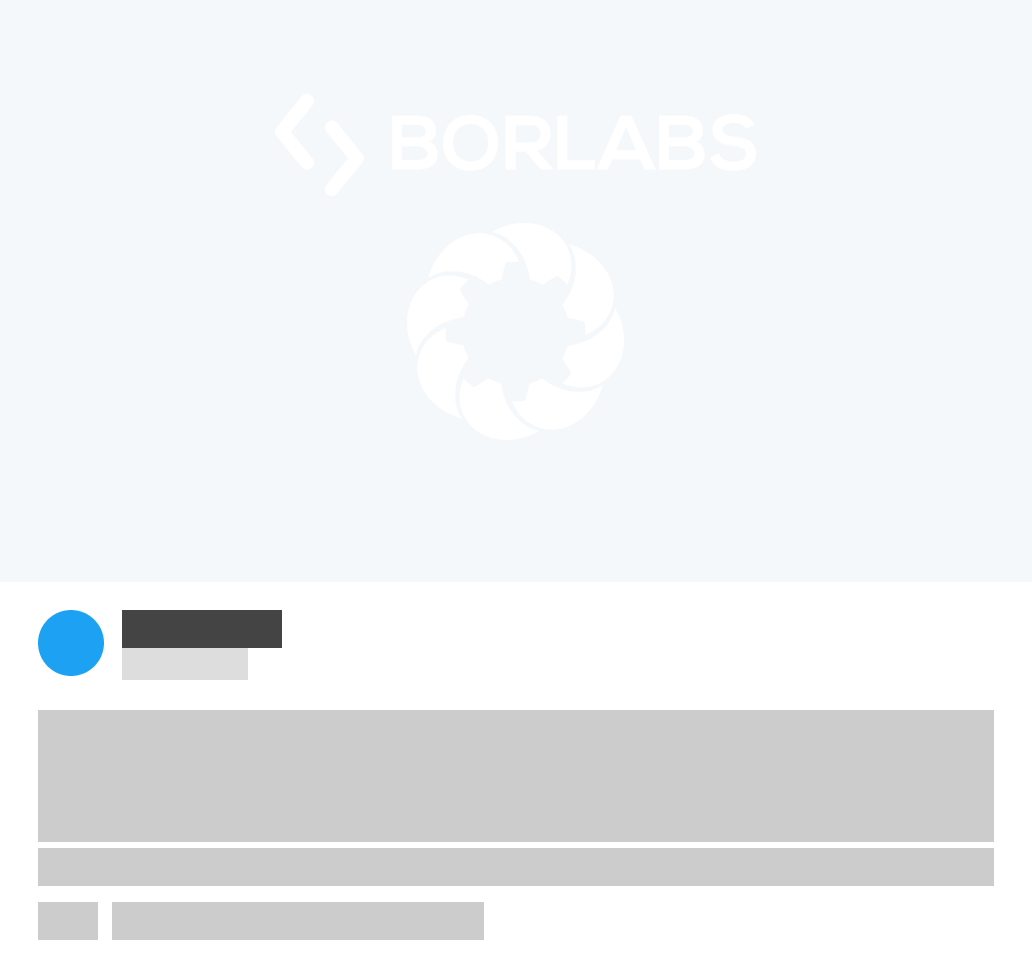Laufen macht Spaß? Für unsere Redakteurin Ellen-Jane Austin ist dieses Konzept in Vergessenheit geraten. Statt Lust auf Bewegung, spürt sie Angst vorm Versagen. Aber sie kann ihre alte Leidenschaft noch nicht aufgeben – und meldet sich zu einem Wettkampf an.
Ein lauer Sommerabend in Berlin. Man könnte meinen, alle Menschen entspannen in Straßencafés und nippen lässig an ihren Gin Tonics. Ich nicht. Ich bin dort, wo die Sportlichen diesen Samstagabend verbringen: beim Adidas City Night Run auf dem Ku’damm.
Um mich herum wuseln unzählige athletische Läufer*innen. Die meisten tragen schon ihre weißen Startnummern. Die Farbe ist sehr wichtig: Weiß steht für den 10-Kilometer-Lauf.
Ich klammere mich an meinen Beutel, in dem ich meine schamhaft rosafarbene Startnummer verstecke. Rosa heißt: 5-Kilometer-Lauf. Rosa heißt: Ich schaffe keine zehn Kilometer im Wettkampftempo.
Ich traue mich noch nicht, sie anzustecken. Sie gibt mir das Gefühl, eine Versagerin zu sein. Ich war nie herausragend schnell, aber eine typische “10km-unter-60Min-gehen-immer”-Läuferin.
Mein ganzer Stolz: der Halbmarathon in unter zwei Stunden. Über die Jahre war das Laufen vom pflichtbelasteten Hobby zur brennenden Leidenschaft geworden. Wenn ich mal zwei Tage nicht flitzen konnte, wurde ich unruhig – sogar unleidig. Statt mir Kraft zu rauben, gab mir jeder Lauf mehr Energie.
Das Leben kam dazwischen
Aus einem Flugzeug betrachtet, sieht die Straße sicher aus, als wäre eine Packung Konfetti geplatzt. Rote, pinke, grüne, blaue und neongelbe Laufklamotten huschen an mir vorbei, machen sich warm und warten freudig ungeduldig auf den Einlass in ihren Startblock.
Ich stehe in einer unbeobachteten Ecke und pinne den rosa Schmach-Zettel an mein dunkel-türkises Funktions-Top. Ich bin nervös. Zum einen, weil ich Angst habe, von jemandem bei so einem kurzen Lauf erwischt zu werden. Zum anderen, weil ich befürchte, dass ich die fünf Kilometer nicht in unter 30 Minuten schaffen könnte. Sechs Minuten auf den Kilometer / zehn Kilometer die Stunde: die universelle “Wer-langsamer-läuft,-kann-nix-Grenze”.
Für ernsthafte Sportler*innen mag mein Gejammer angesichts meiner gar nicht mal so schnellen Zeiten lächerlich klingen. Aber mir gaben sie das Gefühl, fit und leistungsfähig zu sein. Dieses Gefühl zu verlieren, ist unangenehm für das Selbstbewusstsein.
Wie konnte das passieren? Wie konnte ich dermaßen abbauen? Die Antwort ist ekelhaft simpel: Das Leben kam mir dazwischen. Mein größter Fehler war vermutlich, es nach dem Halbmarathon sehr gemütlich anzugehen.
Es war Frühling, die Vögel zwitscherten, die Hormone frohlockten und das geliebte Laufen wurde immer nebensächlicher.
Warum habe ich mich überhaupt angemeldet?
Zweimal wollte ich seitdem wieder einen Halbmarathon rocken. Beide Male kam es nicht zum Start. Ach, es kam ja kaum zum Training – ich war ständig krank.
Dieses Frühjahr ging es sogar so weit, dass ich gut zwei Monate gar nicht laufen war. Grippe, Nebenhöhlenentzündung, Bronchitis – das Einzige was noch lief, war meine Nase, die dafür ununterbrochen. Klar wurde es irgendwann besser, aber ich hatte Angst, wieder krank zu werden.
Der Startschuss ist gefallen und ich hechle durch die Läufer*innen-Masse. Pace: 5:24 – Erleichterung: Das reicht für die unter 30-Minuten-Zeit. Am Straßenrand tanzen Samba-Bands und die Zuschauer*innen halten bunte Schilder hoch, um ihre Liebsten anzufeuern.
Ein kleiner Mann um die 70 in Strickjacke schaut aufgeregt auf die Strecke – auf seiner Pappe steht: “Waltraud, du schaffst das!” – mit roten Herzchen. Ich freue mich für Waltraud und lächle.
Als ich die ein-Kilometer-Markierung sehe, verschwindet das Lächeln. Das Tempo ist anstrengend. War das wirklich mal eine gemütliche Trainingsgeschwindigkeit für mich?
Ein Teil von mir scheint zu glauben, dass ich diese Leistung noch abrufen kann. Kann ich nicht – das wird mir in diesem Moment klar. Warum war ich eigentlich die letzten Wochen nicht trainieren? Die Erkältungswelle ist längst Vergangenheit. Warum also nicht? Warum warte ich bis zu einem Wettkampf? Und warum habe ich mich überhaupt angemeldet?
Doch, ich bin vorher gelaufen – um den Block, auf dem Arbeitsheimweg, in Straßenschuhen, mit Rucksack. Getreu dem Motto: Fünf Minuten laufen, sind besser als gar nicht laufen.
Aber an ein Training mit mehreren Kilometern habe ich mich nicht getraut. Ich hatte unglaublich Bammel, zwischendrin gehen zu müssen, es gar abzubrechen.
Beim Wettkampf würde ich mich durchbeißen, das war mir klar. Und jetzt beiße ich. Und ich habe so gar keine Lust. Ich frage mich, wie ich aus Läufen jemals Freude, ja sogar Kraft ziehen konnte.
Wie ein unbeholfener Pinguin über die Zielmatten
Eigentlich ist die Kulisse traumhaft für einen Lauf: Die Sonne hängt tief über den Hausdächern und taucht alles in dieses honiggoldene Licht, das es nur an Sommerabenden gibt. Außer mir scheinen alle Läufer*innen mit fröhlicher Leichtigkeit über die Strecke zu flitzen. Ich nehme wahr, dass es schön ist hier – ich spüre es bloß nicht.
Vor mir kommt das Ziel in Sichtweite und ich will zum Endspurt Gas geben – früher mein Lieblingsteil jedes Rennens. Ein paar Meter geht es gut, dann wird mir latent übel und ich watschele wie ein unbeholfener Pinguin über die Zielmatten.
Genau 29 Minuten habe ich gebraucht. Der erhoffte Glückstaumel nach dem Rennen bleibt aus. Verdammt, der sollte mich doch kicken, um wieder durchzustarten.
Mein Neuanfang: schildkrötig langsam, aber glücklich
Ein paar Tage später wache ich um kurz nach 6.00 Uhr auf. Die Sonne scheint. Ich will laufen. Ich wälze mich nochmal im Bett und begreife dann erst, was in mir vorgeht:
Ich will wirklich laufen. Alles in mir sehnt sich danach, die Treter zu schnüren, den Kies fliegen zu lassen und frische Luft ein- und auszuhecheln. 15 Minuten später bin ich schildkrötig langsam unterwegs – aber glücklich.
Zwei Tage darauf passiert es wieder. Ich wache auf und zack: Ich hopple durch die Grünanlage. Sogar ein wenig schneller und ein wenig unangestrengter. Ja, der Wettkampf war hart für mich – aber mit verklärtem Blick in die Vergangenheit hat er doch irgendwie Spaß gemacht. Und er scheint etwas in mir ausgelöst zu haben: Ich glaube, das ist mein Neuanfang.