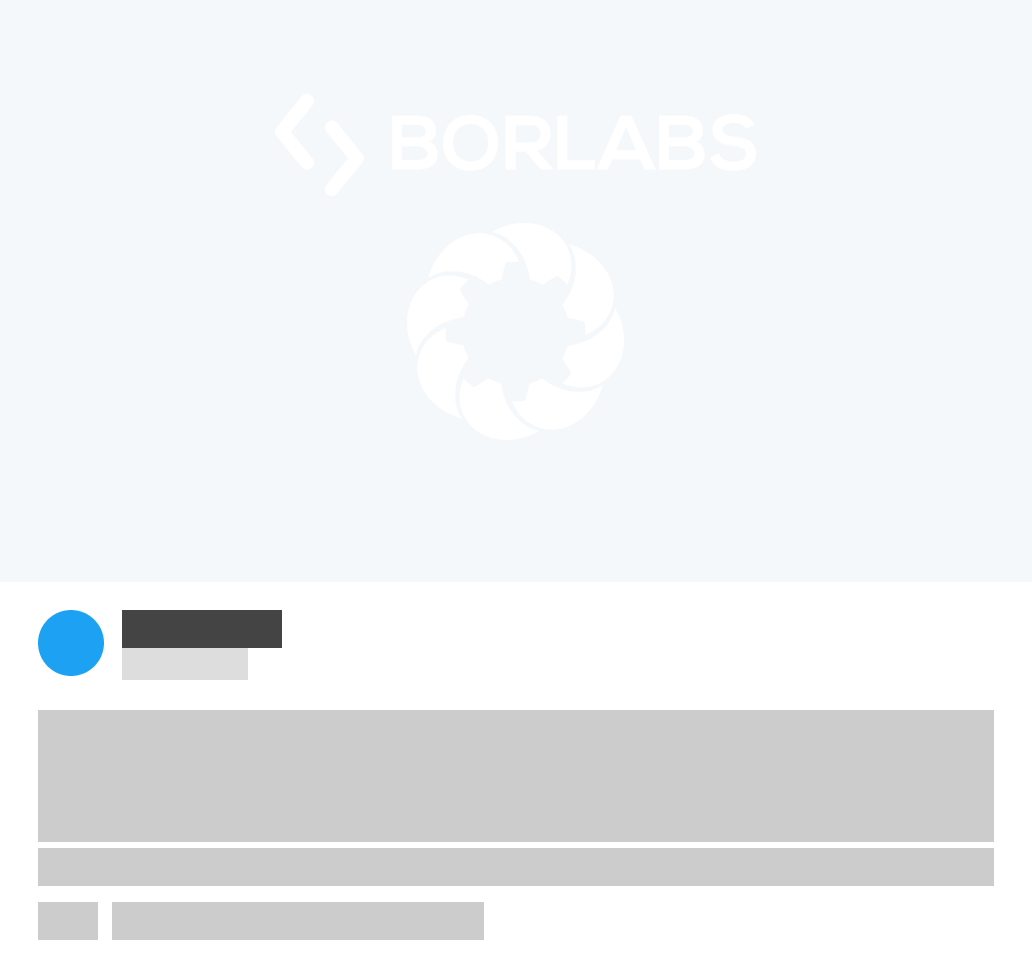Radfahren ist gesund – eigentlich. Doch was passiert, mit den Radler*innen, wenn der Schulterblick von Autofahrer*innen ausbleibt? Geht meist nicht gut aus. Ein Plädoyer für mehr Verkehrssicherheit.
Was ein furchtbares Wochenende: Am Samstag übersieht ein abbiegender Laster in Kreuzberg einen Radfahrer. Tot. Am Sonntag rasen zwei Rennradler am Wannsee ungebremst in einen Geländewagen, einer direkt durch die Heckscheibe. Ein Streckenposten wird umgefahren, ein dritter Radler in den Sturz verwickelt. Spätfolgen ungewiss.
Wie in der Hauptstadt gilt überall in Deutschland: Frühlingszeit – Radunfallzeit. Seit Jahren erwischt es jedes Jahr in Deutschland etwa 400 Menschen, rund 80.000 werden verletzt, 15.000 davon schwer. Unklar bleiben Dunkelziffer und Spätfolgen.
Sicher ist nur: Wer weitgehend ungeschützt mit einem Auto kollidiert, ist im Nachteil, erst recht, wenn die Zahl schwachsinnig hochgerüsteter und martialischer SUVs stetig zunimmt.
Wir sorgen uns um Terrorismus, wir fahnden Mikrospuren irgendwelcher Allergene hinterher – aber eine der geläufigsten lebensverkürzenden Bedrohungen im Alltag nehmen wir als quasi-schicksalhaft an. Wer je an einem Volksradrennen teilnahm, ist vertraut mit dem Knirschen, wenn Karbon auf Alu, auf Asphalt, auf Knochen, auf Schneidezahn prallen und einige Quadratzentimeter Haut auf der Straße bleiben.
Wer je in einer deutschen Großstadt mit dem Rad unterwegs war, kennt die vielen Alltagssituationen, wenn der Schulterblick der Autofahrer*innen ausbleibt, wenn ungeduldige Pilot*innen aus Einfahrten auf den Radweg oder haarscharf an Radler*innen vorbeischießen, bisweilen unverhohlen aggressiv. Wer seine Kinder morgens mit dem Rad zur Schule lässt, schickt immer auch ein Gebet mit, dass all die gehetzten Morgenmuffel ihre Übellaunigkeit auf wen anders projizieren als unseren Nachwuchs.
Nein, es sind nicht die Autofahrer*innen allein, es ist ein gesamtgesellschaftliches Klima, das nervt und obendrein lebensgefährlich ist. Radaktivist*innen mit ihren Lärmgerätschaften, ihrer Aggressivität und dem Bessermenschenblick tragen ebenso wenig zu einem gedeihlichen Miteinander bei wie Autofahrer*innen, die die Wutmenschenparole von der “freien Fahrt für freie Bürger*innen” vor sich hin murmeln.
Und wie soll die Straße erst aussehen, wenn Lastenräder und E-Bikes, Mannschaftsräder, Segways und Hoverboards in noch größerer Zahl durch die Städte ruckeln, rasen oder fliegen?
Im Vergleich zur Gleichberechtigung auf der Straße ist die Emanzipation weit fortgeschritten. Höchste Zeit, dass ein Konsens darüber herbeigeführt wird, wie die Prioritäten liegen: Ein*e Autofahrer*in, der es eilig hat, genießt keinesfalls automatisch Vorfahrt.
Wer einen Geländewagen pilotiert, der ein deutlich höheres Verletzungsrisiko für ungeschützte Verkehrsteilnehmer*innen bedeutet, ist im Unfallfall besonders empfindlich zu bestrafen. Radfahrer*innen, die eine rote Ampel oder ordentliche Beleuchtung (mea culpa!) allenfalls für einen Vorschlag halten, ebenfalls.
Wer Radrennen veranstaltet, hat dafür Sorge zu tragen, dass die Teilnehmer*innen im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte sind. Wer jemals erlebte, wie sich erwachsene Menschen, vorwiegend Männer in den besten Jahren, in Zombies verwandeln, sobald sie auf ihren teuren Rennmaschinen Platz genommen haben, der nimmt freiwillig Abstand von Volksrennen. Vorübergehende oder lebenslängliche Sperren für Bike-Hooligans dürfen kein Tabu sein.
Ein Wort noch zu den Streckenposten: Wer freiwillig stundenlang mit einem Fähnchen in einer Einfahrt steht, um eine Rennstrecke zu bewachen, dem gilt zunächst einmal der herzlichste Dank aller Freizeit-Sportler*innen.
Andererseits gehört es zur bösen Realität, dass nicht immer die hellsten Kerzen auf dem Kuchen zum Streckendienst abkommandiert werden. Nicht die respektgebietende Warnweste, sondern klare Ansagen und eindeutiges Verhalten machen aus einem Streckenposten eine Respektsperson.
Und schließlich das Verkehrsrecht: Wenn hirnamputierte Raser*innen wegen Mordes verurteilt werden können, warum dann nicht auch rücksichtslose Autopilot*innen, die Radler*innen zu Tode fahren? Zugleich müssen Radfahrer*innen für ihre zahllosen großen und kleinen Vergehen empfindlich bestraft werden.
Die vergangenen Jahre haben gezeigt: Wildwuchs, Augenzudrücken und das Hoffen auf Vernunft zeigen keine große Wirkung. Selbstorganisation funktioniert nicht. Der Erfolg von Radfahrstädten oder Ländern mit deutlich positiverer Unfallstatistik ist auch darauf zurückzuführen, dass die Polizei humorlos mit Verkehrssünder*innen umgeht. Nicht schön, aber lebensverlängernd.